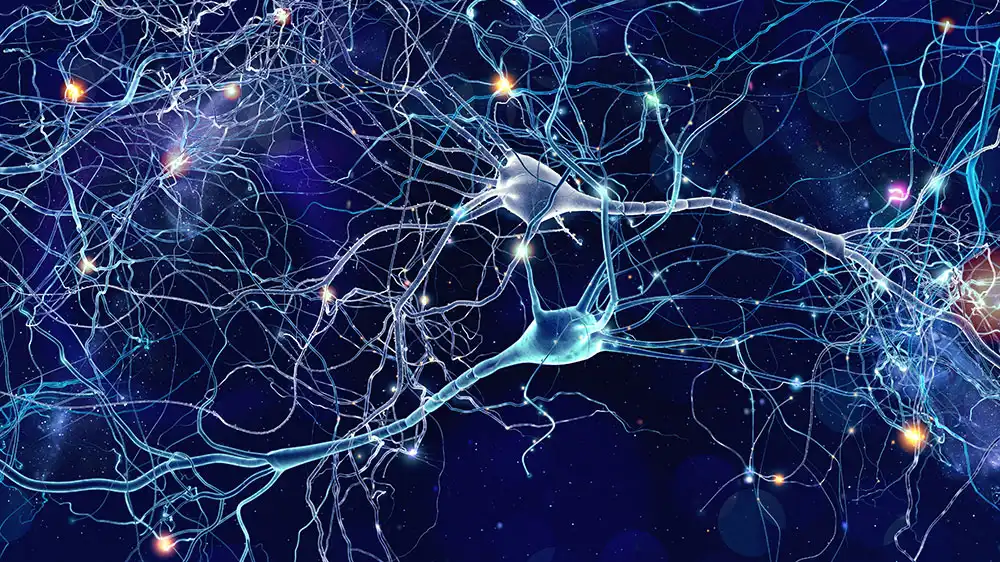
Therapeutische Anwendungen von Botulinumtoxin (BoNT)
Botulinumtoxin Typ A ist in Deutschland zur Behandlung zahlreicher neurologischer und nicht-neurologischer Erkrankungen zugelassen. Dazu zählen u.a.:
- Fokale Dystonien (z. B. zervikale Dystonie, Blepharospasmus)
- Spasmus hemifacialis
- Spastik der oberen und unteren Extremitäten bei Kindern und Erwachsenen
- Chronische Migräne
- Neurogene Blasenfunktionsstörungen
- Axilläre Hyperhidrose
- Sialorrhoe
Wichtig: Die Zulassungen der verschiedenen BoNT-Präparate (z. B. OnabotulinumtoxinA, AbobotulinumtoxinA, IncobotulinumtoxinA, RimabotulinumtoxinB) unterscheiden sich teils deutlich. Bitte beachten Sie stets die aktuelle Fachinformation des jeweiligen Präparats.
Zugelassene therapeutische Anwendungen von Botulinumtoxin in Deutschland
(Stand: 2025, je nach Präparat – vgl. Fachinformation)
- Zervikale Dystonie
Fokale Dystonie mit unwillkürlicher Anspannung der Halsmuskulatur, die zu schmerzhaften, abnormen Kopfhaltungen führt. BoNT ist Therapie der ersten Wahl laut DGN-Leitlinie.
📚 DGN-Leitlinie Dystonien (2021); Jankovic J. et al., Lancet Neurol 2008
- Blepharospasmus
Fokale Dystonie mit unwillkürlichem, anfallsartigem Lidschluss durch Überaktivität der Augenringmuskulatur. BoNT ist effektiv und standardmäßig empfohlen.
📚 Hallett M. et al., Neurology 2013; DGN-Leitlinie Dystonien (2021)
- Spasmus hemifacialis
Einseitige klonische oder tonische Zuckungen der Gesichtsmuskulatur infolge peripherer Irritation des N. facialis, meist durch Gefäßkompression. BoNT zeigt hohe Wirksamkeit bei guter Verträglichkeit.
📚 Tan EK et al., Neurology 2002; DGN-Leitlinie Dystonien (2021)
- Spastik bei Erwachsenen
Muskelüberaktivität infolge zentraler Läsionen (z. B. Schlaganfall, MS, TBI), die die Beweglichkeit einschränkt und Schmerzen verursachen kann. BoNT dient der gezielten Tonusminderung einzelner Muskelgruppen.
📚 Simpson DM et al., Neurology 2008; DGN-Leitlinie Spastik (2023)
- Spastik bei Kindern mit infantiler Zerebralparese
Bei selektivem Einsatz verbessert BoNT die Funktion und reduziert Fehlstellungen. Bestandteil multimodaler Therapiekonzepte.
📚 Heinen F. et al., Lancet Neurol 2010; European consensus 2021
- Chronische Migräne
≥15 Kopfschmerztage pro Monat, davon ≥8 mit migränetypischer Symptomatik. BoNT verringert Frequenz und Intensität der Attacken signifikant.
📚 PREEMPT-Studien: Aurora SK et al., Cephalalgia 2010; Diener HC et al., Cephalalgia 2010; DGN-Leitlinie Migräne (2022)
- Neurogene Detrusorüberaktivität
Überaktive Blase mit imperativem Harndrang und Inkontinenz bei MS oder Querschnittsyndromen. BoNT reduziert die Detrusoraktivität und verlängert die Kontinenzphasen.
📚 Cruz F et al., Eur Urol 2011; DGN-Leitlinie Neurogene Blasenstörungen (2020)
- Axilläre Hyperhidrose
Übermäßiges Schwitzen in den Achseln, das sich durch konventionelle Maßnahmen nicht kontrollieren lässt. BoNT hemmt vorübergehend die cholinerge Schweißdrüsenaktivität.
📚 Naumann M et al., Br J Dermatol 2003; Heckmann M et al., Arch Dermatol 2001
- Chronische Sialorrhoe (z. B. bei ALS, Parkinson, Zerebralparese)
Pathologisch gesteigerter Speichelfluss mit sozialer Beeinträchtigung und Aspirationsrisiko. BoNT in die Speicheldrüsen reduziert effektiv die Speichelproduktion.
📚 Restivo DA et al., Parkinsonism Relat Disord 2012; Leitlinie Sialorrhoe (2018)
Wissenschaftliche Grundlage
Die therapeutischen Anwendungen basieren auf Evidenz aus randomisierten, kontrollierten Studien sowie klinischer Erfahrung. Die Leitlinien der Fachgesellschaften und Fachinformationen der Präparate sind dabei die zentrale Entscheidungsgrundlage.
Hinweis für Ärztinnen und Ärzte: Die Inhalte dieser Seite dienen der ärztlichen Fortbildung und der Information über den aktuellen Stand der BoNT-Therapie. Für individuelle Therapieentscheidungen sind die jeweils aktuellen Fachinformationen sowie die DGN-Leitlinien maßgeblich.
Die zervikale Dystonie ist eine fokale Form der Dystonie, bei der es zu unwillkürlichen, oft schmerzhaften Kontraktionen der Hals- und Nackenmuskulatur kommt. Dies führt zu abnormen Kopfhaltungen (Torticollis, Laterocollis, Retrocollis) und funktionellen Einschränkungen. Neben Schmerzen kann die Erkrankung auch psychosozial belastend sein. Botulinumtoxin wird als Therapie der ersten Wahl empfohlen, da es gezielt die überaktive Muskulatur relaxiert. Die Wirkung tritt typischerweise innerhalb weniger Tage ein und hält etwa drei Monate an. Eine regelmäßige Injektionstherapie ermöglicht eine langfristige Symptomkontrolle.
📚 DGN-Leitlinie Dystonien (2021); Jankovic J. et al., Lancet Neurol 2008
Der Blepharospasmus ist eine fokale Dystonie, die durch unwillkürliche Kontraktionen der Mm. orbicularis oculi gekennzeichnet ist. Betroffene leiden unter häufigem, anfallsartigem Lidschluss, der zur funktionellen Blindheit führen kann. Die Symptome treten oft beidseitig auf und beginnen meist schleichend. Botulinumtoxin ist die Therapie der ersten Wahl und wirkt durch Hemmung der präsynaptischen Acetylcholinausschüttung an den motorischen Endplatten. Die Injektion erfolgt präzise in die betroffenen Muskeln im Bereich der Lidregion. Die Wirkung setzt nach wenigen Tagen ein und hält etwa 8 bis 12 Wochen an.
📚 Hallett M. et al., Neurology 2013; DGN-Leitlinie Dystonien (2021)
Beim Spasmus hemifacialis handelt es sich um eine periphere Fazialisneuromyotonie, bei der es zu klonischen und später auch tonischen Zuckungen der einseitigen Gesichtsmuskulatur kommt. Meist liegt eine vaskuläre Kompression im Bereich der Fazialiswurzel vor. Die Symptome beginnen typischerweise im Augenbereich und breiten sich auf die untere Gesichtshälfte aus. Botulinumtoxin reduziert die muskuläre Überaktivität effektiv und wird minimalinvasiv per Injektion appliziert. Besonders bei fortgeschrittener Symptomatik oder fehlender OP-Indikation stellt BoNT eine sichere und gut verträgliche Therapieoption dar. Die Behandlung wird regelmäßig wiederholt, um die Wirkung zu erhalten.
📚 Tan EK et al., Neurology 2002; DGN-Leitlinie Dystonien (2021)
Die spastische Tonuserhöhung entsteht meist infolge zentraler Läsionen wie Schlaganfall, Multipler Sklerose, Rückenmarksläsion oder Schädel-Hirn-Trauma. Sie führt zu Muskelverhärtungen, Bewegungseinschränkungen und funktioneller Beeinträchtigung, teilweise auch zu Schmerzen oder Hygieneschwierigkeiten. Botulinumtoxin wird bei fokaler oder multifokaler Spastik eingesetzt, um gezielt einzelne überaktive Muskeln zu entspannen. Die Wirkung zeigt sich nach wenigen Tagen und hält meist zwei bis vier Monate an. Die Behandlung erfolgt in der Regel in Kombination mit Physiotherapie und Orthesenversorgung. BoNT kann die Lebensqualität signifikant verbessern und orthopädische Sekundärschäden vermeiden helfen.
📚 Simpson DM et al., Neurology 2008; DGN-Leitlinie Spastik (2023)
Kinder mit ICP entwickeln häufig eine spastische Tonuserhöhung, die zu Fehlhaltungen, Kontrakturen und Bewegungseinschränkungen führt. Botulinumtoxin ist bei milden bis moderaten Formen zur Behandlung selektiver Muskelgruppen zugelassen. Ziel ist die Funktionsverbesserung, Schmerzreduktion und ggf. das Vermeiden oder Hinauszögern operativer Eingriffe. Die Anwendung erfordert eine sorgfältige Indikationsstellung und ist Teil eines umfassenden Behandlungskonzepts mit Physiotherapie, Hilfsmitteln und ggf. orthopädischen Maßnahmen. Die Therapie wird individuell auf das Entwicklungsstadium und die funktionellen Ziele des Kindes abgestimmt.
📚 Heinen F. et al., Lancet Neurol 2010; European Consensus 2021
Die chronische Migräne ist definiert durch ≥15 Kopfschmerztage pro Monat, davon ≥8 Tage mit migränetypischer Symptomatik über mindestens drei Monate. Viele Patient:innen sprechen unzureichend auf klassische Migräneprophylaktika an. Botulinumtoxin A (OnabotulinumtoxinA) wird im Rahmen des sog. PREEMPT-Protokolls in standardisierte Kopf- und Nackenmuskeln injiziert. Es reduziert die Anzahl der Kopfschmerztage sowie die Schmerzintensität signifikant. Die Wirkung tritt nach etwa zwei Wochen ein und stabilisiert sich nach mehreren Zyklen. BoNT ist bei nachgewiesener chronischer Migräne und ausbleibendem Ansprechen auf andere Prophylaktika zugelassen.
📚 Aurora SK et al., Cephalalgia 2010; Diener HC et al., Cephalalgia 2010; DGN-Leitlinie Migräne (2022)
Bei Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder Querschnittlähmung kann es zu einer überaktiven Blase mit imperativem Harndrang und Inkontinenz kommen. Die medikamentöse Therapie mit Anticholinergika oder Betmiga reicht oft nicht aus oder ist schlecht verträglich. Botulinumtoxin wird endoskopisch direkt in den Detrusormuskel injiziert, wo es die cholinerge Aktivität hemmt und so den Blasendruck senkt. Dies führt zu einer verbesserten Kontinenz und reduzierter Lebensqualitätseinschränkung. Die Therapie ist reversibel und kann bei nachlassender Wirkung wiederholt werden. Voraussetzung ist ein adäquates Kathetermanagement bei möglicher Restharnbildung.
📚 Cruz F et al., Eur Urol 2011; DGN-Leitlinie Neurogene Blasenstörungen (2020)
Bei der primären axillären Hyperhidrose kommt es zu übermäßiger Schweißproduktion in den Achselhöhlen, die über das für die Thermoregulation notwendige Maß hinausgeht. Die Erkrankung beginnt meist in der Pubertät und kann erheblichen sozialen und beruflichen Leidensdruck verursachen. Botulinumtoxin hemmt die cholinerge Übertragung auf die ekkrinen Schweißdrüsen. Die Wirkung setzt nach wenigen Tagen ein und hält durchschnittlich vier bis neun Monate an. Die Behandlung gilt als effektiv, gut verträglich und ist eine Alternative zur systemischen oder chirurgischen Therapie. Sie wird ambulant durchgeführt und erfordert keine besondere Nachsorge.
📚 Naumann M et al., Br J Dermatol 2003; Heckmann M et al., Arch Dermatol 2001
Sialorrhoe (pathologischer Speichelfluss) tritt häufig bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, ALS oder ICP auf. Sie kann zu sozialer Stigmatisierung, Hautreizungen und Aspirationsgefahr führen. Botulinumtoxin wird ultraschallgesteuert in die großen Speicheldrüsen (v. a. Glandula parotis und submandibularis) injiziert und reduziert dort selektiv die Speichelproduktion. Die Wirkung tritt nach etwa einer Woche ein und hält meist drei bis vier Monate an. Die Therapie ist gut verträglich und stellt eine wichtige nicht-invasive Behandlungsoption dar.
📚 Restivo DA et al., Parkinsonism Relat Disord 2012; Leitlinie Sialorrhoe (2018)
Diese Anwendungen erfolgen außerhalb der Zulassung, können aber klinisch sinnvoll sein und werden durch Erfahrung gestützt. In vielen Fällen werden sie in Leitlinien oder von Fachgesellschaften empfohlen. Hierbei werden nur einige Beispiele genannt.
Bewegungsstörungen / Neurologie
- Tremor (z. B. bei Parkinson oder essenziellem Tremor): Reduktion der Tremoramplitude durch gezielte Injektionen in verantwortliche Muskelgruppen.
- Segmentale und generalisierte Dystonien (z. B. Rumpfdystonie, Schreibkrampf): Linderung fokaler Symptome auch bei komplexeren Dystonieformen.
Urologische Indikationen
- Nicht-neurogene überaktive Blase: Drangsymptomatik kann durch intravesikale Injektionen gebessert werden.
- Blasenentleerungsstörungen: Sphinkterrelaxation zur Verbesserung der Miktion.
Gastrointestinale Beschwerden
- Achalasie: Entspannung des unteren Ösophagussphinkters bei Schluckstörungen.
- Anismus / dyssynergische Defäkation: Unterstützung der Darmentleerung durch Muskelentspannung.
- Gastroparese (pylorischer Spasmus): Verbesserung der Magenentleerung durch Relaxation des Pylorus.
Hals-Nasen-Ohren-Bereich / Dysphagie
- Spasmodische Dysphonie (Stimmbanddystonie): Wiederherstellung einer kontrollierten Stimmgebung.
- Cricopharyngeusdysfunktion / Globusgefühl: Verbesserung von Schluckvorgängen durch gezielte Injektionen.
Dermatologische Indikationen
- Hyperhidrose außerhalb der Achseln: Reduktion der Schweißproduktion z. B. an Händen, Füßen oder Stirn.
Betroffene und Angehörige finden Unterstützung bei Selbsthilfegruppen. Eine bundesweite Übersicht bietet die NAKOS – Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen: